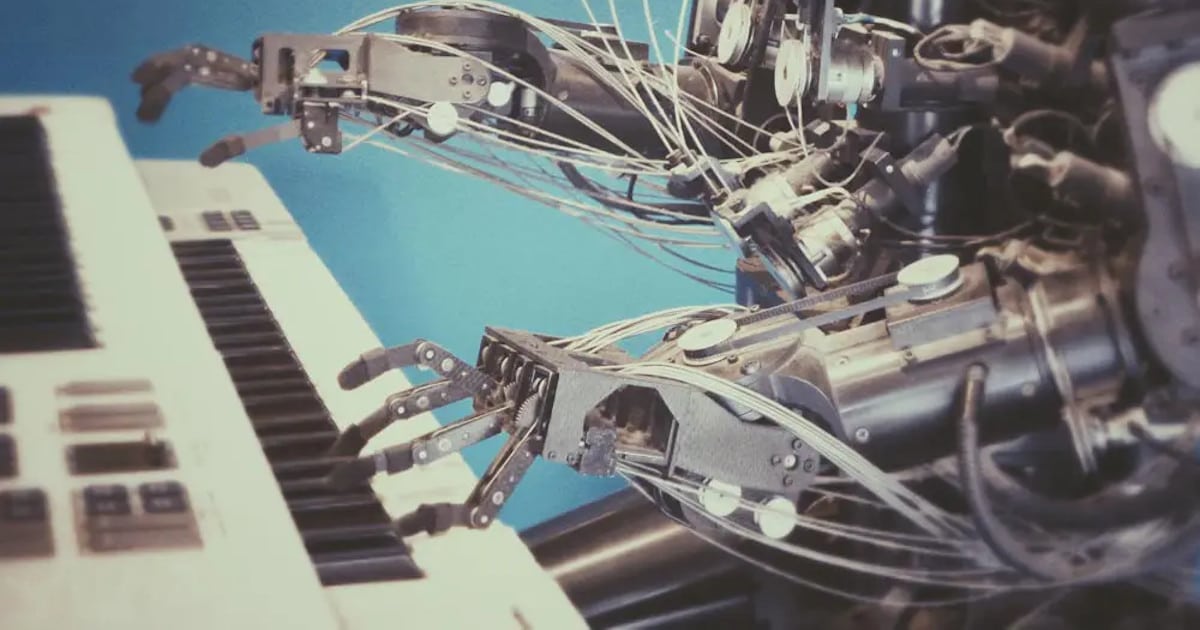Die Digitalisierung bringt für den Handel fundamentale Änderungen mit sich. Der Digitale Wandel hat Auswirkungen auf den Kaufprozess der Kunden. Was für den Handel seit Jahrzehnten Gültigkeit hatte, wurde durch die Digitalisierung verändert. Beinahe jeder hat heute durch das Internet uneingeschränkten Zugang zu allen Informationen.
Das bringt eine Verschiebung der Entscheidungsinstanzen mit sich und neue Akteure treten im Kaufprozess auf. Durch E-Commerce kam es zu einem Paradigmenwechsel im Handel. Weitere Entwicklungsstufen gehen von mobilen Endgeräten (Smartphone, Tablet) aus, die sich über das Serviceangebot von mobilen Endgeräten (Apps, Abos etc.) auswirken.
Vom Handel 1.0 zum Handel 2.0
Der traditionelle Kaufprozess sah früher, einfach gesagt, wie folgt aus: Nach einem Kaufimpuls – Idee, Bedarf – machte man sich eine Notiz (z.B. Einkaufsliste). Mit der Fahrt oder dem Gang zum Händler seiner Wahl und der Auswahl des gewünschten Produktes wurde der Kaufprozess abgeschlossen.
Mehr über Digitalisierung und Künstliche Intelligenz erfahren Sie bei unseren Tagungen zu den Themen
Beim Kaufprozess im Handel 1.0 lag die Entscheidungshilfe, wie auch die Beratungskompetenz, beim Händler. Dies hat sich im Zeitalter des E-Commerce geändert. Es gibt eine große Anzahl von Auswahl- und Entscheidungshilfen: Homepages der Hersteller, Testberichte im Internet, Vergleichs- und Preisportale bis hin zu Erfahrungsberichten in den Sozialen Medien.
Mit E-Commerce tritt die Produktauswahl vor die Händlerauswahl. Als Entscheidungshelfer treten Vermittler, wie z.B. Google oder Amazon, auf. Doch auch im Zeitalter des Onlineshoppings kommt nach dem Kaufimpuls erst eine Wartefrist. Vor dem Kauf wird erst im Internet, auf Rechnern im Büro oder am privaten, recherchiert. Es werden Erfahrungsberichte gelesen oder die günstigsten Preise für das gewünschte Produkt gesucht.
Mobile Endgeräte im Kaufprozess
Mobile Endgeräte bringen ein neues Momentum in den Kaufprozess ein. Der Kaufprozess rückt zeitlich zum Impuls vor, da mobile Endgeräte die Wartefrist auf den Kauf verkürzen und das Recherchieren jederzeit ermöglichen. Mit dem Smartphone oder Tablet ist es jederzeit und quasi von jedem Ort aus möglich Erfahrungswerte zu Produkten einzuholen. Spontankäufe nehmen durch den Wegfall der zeitlichen Verzögerung zu – geplante Käufe hingegen ab. Durch innovative Shopping-Apps wird die Anzahl der Händler minimiert. Der Kaufprozess verlässt das eigene Ökosystem nicht mehr, was wiederum Mitbewerber ausschließt.
Services zur Bindung der Kunden
Eine interessante Ausprägung im E-Commerce sind Services, wie Abo-Modelle – z.B. Amazon Prime, Vorteilskarten – die es schaffen, den Wettbewerb teilweise auszuschalten. Den Wettbewerb wirklich auf Distanz halten können sie im Kontext der Veränderung des Kaufprozesses vor allem im Fulfillment. Eine aktuelle Studie zeigt, dass nur noch 1% der Amazon-Prime Kunden bei anderen Händlern vergleichen.
Zum Beispiel das Konzept von Amazon-Prime: Gegen eine Jahresgebühr entfallen die Versandkosten. Eine sehr schnelle Lieferung wird garantiert. Der Service bietet noch weitere Vorteile, wie etwa der Zugang zum Streaming-Angebot.
Service-Angebote in diesem Bereich schalten den Wettbewerb praktisch komplett aus. Grundsätzlich stellt das eine Rückkehr zum Handel 1.0 dar, jedoch in einer monopolistischen Ausprägung, da die Auswahl der Anbieter praktisch entfällt.
Shopping-Devices zur Bindung der Kunden
Amazon experimentiert bereits seit längerem mit verschiedenen Shopping-Devices. Erst kam Amazon-Dash als Shopping-Stick. Ein Druck auf den Knopf des Sticks reicht aus, um ein Produkt zu bestellen. Später kam Amazon-Echo, ein sprachgesteuerter Shopping-Assistent. Durch den Dash-Button oder Alexa rückt der Produktkauf noch näher an den Kaufimpuls. Ein weiterer Vorteil solcher Shopping-Devices für den Händler ist, dass dadurch die Recherche des Kunden wegfällt. Der Kunde bleibt bei einem ihm bekannten Produkt und vergewissert sich nicht, ob das Produkt bei anderen Anbietern günstiger wäre.
Fazit
Die Digitalisierung brachte mit dem anfänglichen Paradigmenwechsel, Tausch von Händler- und Produktauswahl, weitere Entwicklungsstufe im Kaufprozess mit sich. Mobile Endgeräte verkürzen die Wartefrist bis zum Kauf und die nachfolgenden Entwicklungen schalten den Wettbewerb immer mehr aus. Der Produktkauf rückt immer mehr an den Kaufimpuls heran. Auch die Akteure im Kaufprozess haben sich verändert. Der Händler ist nicht mehr die erste Ansprechperson bei der Produktauswahl.
Es sind Erfahrungsberichte aus dem Internet und Vergleichsportale, die dem Kunden die Entscheidung vereinfachen.
Sie wollen mehr über dieses und andere spannende Themen erfahren? Dann melden Sie sich einfach zu unserem Newsletter an oder besuchen Sie eine unserer Tagungen.
Dieser Beitrag hat Ihnen gefallen? Informieren Sie sich auch über unsere Tagungen zu den folgenden Themen: