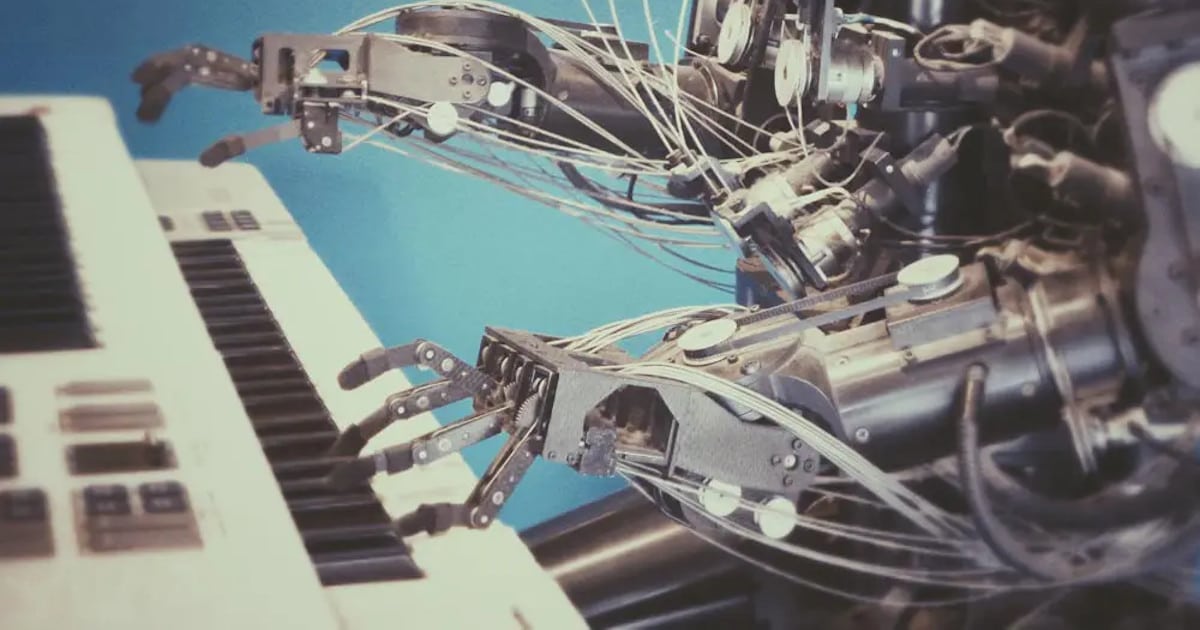Von 22. Mai bis 24. Mai fand der diesjährige Akademie3 Kongress zum Thema Künstliche Intelligenz im Finanz- und Rechnungswesen sowie im Controlling statt. Drei Tage lang wurden die derzeitigen Entwicklungen in diesem Bereich erörtert. Auch einen Ausblick auf künftige Veränderungen hat es gegeben. Renommierte Experten zeigten anhand einiger Beispiele, welche Fortschritte die Künstliche Intelligenz in ihrer Branche mit sich bringt. Wir waren auch vor Ort und wollen diesen kurz zusammenfassen:
Ein spannender Tag beginnt
Pünktlich um 9:00 Uhr beginnt der dritte Kongresstag mit einem Vortrag zur Künstlichen Intelligenz in der Praxis. Die Anwendungsfelder der KI werden darin vorgestellt. Etwa das Erkennen von Anomalien im Zahlungsverkehr oder das Auslesen und Bewerten von Verträgen. Auch die Vorstellung von Robotic Process Automation mit der Übernahme von Routineaufgaben durch KI ist Thema. Vortragender ist Bernhard Niedermayer von Catalyst, Leiter des Geschäftssegment Emerging Technologies. Auch für Entwicklungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Big Data Analytics, Augmented Reality, Internet der Dinge und Blockchain ist er zuständig.
Mehr über Digitalisierung und Künstliche Intelligenz erfahren Sie bei unseren Tagungen zu den Themen
Nach einer halbstündigen Pause – mit Brötchen und Mehlspeisen – geht es mit dem zweiten Vortrag los. Marina Kern, B.Sc. und Mag. Reinhard Taucher von SAP stellen dabei das neue Programm S/4HANA vor. Sie erläutern, wie Unternehmen maschinelles Lernen in die Unternehmensabläufe integrieren und nutzen können. Ein Beispielvideo zeigt zudem, wie das Programm die Abläufe vereinfacht und welche Vorteile der Anwender durch das Programm erhält.
Networking inklusive
Im Anschluss an den Vortrag findet die Mittagspause statt. Im Speisesaal des Bürogebäudes kann man zwischen verschiedenen Speisen wählen. Die Mittagspause stellt auch eine gute Gelegenheit dar, um sich mit anderen Teilnehmern des Kongresses auszutauschen.
Den nächsten Programmpunkt hält Dominique Ray von Grant Thornton ab. Er ist Wirtschaftsprüfer von Banken und Finanzintermediär. Sein Fokus liegt auf der Digitalisierung des Audits und der internen Revision. Der Vortrag zeigt auf, wie in Echtzeit Prüfstandards automatisiert und für die interne Revision relevante Parameter überwacht werden können. Auch, wie ein digitales Konzept die Bereiche Finanz, Audit und Internat Audit verbessern kann und wo die Grenzen der digitalen Anwendung liegen, wird erläutert. Anhand von verständlichen, praktischen Beispielen wird ein komplexer Bereich für alle Teilnehmer sehr gut erklärt.
Um die immer größer werdenden Datenmengen, die es zu untersuchen gilt, geht es im Vortrag von Dr. Christian Kurz und DI Alexander Schneider, B.Sc. Beide Speaker sind bei PwC tätig. Dr. Kurz ist Senior Manager im Bereich Forensic Services. Zudem ist er auf Computer Forensics, Electronic Discovery, Cyber Forensics und Data Analytics spezialisiert. DI Schneider, B.Sc. ist Senior Associate im Bereich Forensic Services. Seine Spezialgebiete liegen bei den Themen Digitale Forensik, eDiscovery und Security Awareness. Ihr Vortrag dreht sich um die spannende Frage, wie man mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz unstrukturierte Datenmengen untersuchen kann. Da die manuelle Bearbeitung dieser großen Datenmengen nicht mehr möglich ist, stellen sie die Software „Brainspace“ vor. Diese ermöglicht es, unstrukturierte Daten (z.B. E-Mails, Office Dokumente oder Inhalte von Smartphones) effizient zu filtern und zu untersuchen.
Zahlreiche renommierte Speaker teilen ihr Expertenwissen
Den Abschluss bildet ein Vortrag zur Betrugserkennung anhand von Advanced Analytics. Er soll die strategische Zielsetzung und den analytischen Ansatz von Betrugserkennung (Fraud Detection) vermitteln. Dieser findet unter anderem auch beim österreichischen Bundesministerium für Finanzen Anwendung. Das Ziel besteht darin, Daten durch innovative Methoden (u.a. Predictive Analytics) zu analysieren. In weiterer Folge soll über deren Muster bzw. Datencharakteristik auf Unregelmäßigkeiten und mögliche Betrugsfälle geschlossen werden. Martin Setnicka, Ph.D. ist ehemaliger Leiter des Predictive Analytics Competence Center des österreichischen Bundesministeriums für Finanzen und Vortragender dieses Programmpunktes.
Ein sehr interessanter Kongresstag geht zu Ende. Anschließend lässt man mit anderen Teilnehmern den Tag Revue passieren und tauscht sich über das neu Gelernte aus.
Sie hat unser Bericht „Künstliche Intelligenz im Finanz- und Rechnungswesen sowie im Controlling“ angesprochen? Dann könnte unsere jährliche Wiener Tagung zur Internationalen Rechnungslegung auch interessieren. Wenn Sie noch mehr zum Thema Künstliche Intelligenz und Wirtschaft erfahren wollen, melden Sie sich doch für unseren Newsletter an. So bleiben Sie über unser aktuelles Veranstaltungsangebot immer top informiert.
Dieser Beitrag hat Ihnen gefallen? Informieren Sie sich auch über unsere Tagungen zu den folgenden Themen: